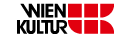Eine Art Heiliger, aber rot
Die Zentrale der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main und der Karl Marx-Hof in Wien haben nichts miteinander zu tun. 99 von 100 Befragten würden so antworten. 99 Prozent würden mit dieser Antwort falsch liegen. Den beiden Gebäuden, das eine aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das zweite aus dem ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, können zwei Charakteristika zugeschrieben werden, die ident sind. Beide sind global beachtete Hervorbringungen innovativer österreichischer Architektur – und beide signalisieren das Verschwinden des utopischen Gehalts aus dem jeweiligen architekturpolitischen Ursprungskonzept. Meine Prognose: in 50 Jahren wird der Prix-Wolkenkratzer ein No Name unter der mehr als 150 Meter hohen Massenware sein, während der 1.400 Wohnungen umfassende Bau des Otto Wagner-Schülers Karl Ehn in Wien-Heiligenstadt endgültig zum Mekka der Architektur-und Sozialismusversteher geworden sein wird. Weltweit.
Architektur muss geil sein und fetzen, sagte einst Herr Wolf D. Prix, der zusammen mit Helmut Swiczinsky die sich als avantgardistisch verstehende Architektengruppe Coop Himmelb(l)au gründete, die in den letzten beiden Jahrzehnten zum prominentesten Architekturexport Österreichs heranwuchs. Zuletzt baute der Global Player aus Wien den Palast seines «Feindes»: die Zentrale der Europäischen Zentralbank. Auch eine 68er-Geschichte...
«Wir haben keine Lust, Biedermeier zu bauen (…) Wir wollen Architektur, die mehr hat. Architektur, die blutet, die erschöpft, die dreht und meinetwegen bricht. Architektur, die leuchtet, die sticht, die fetzt und unter Dehnung reißt. Architektur muss feurig, glatt, hart, eckig, brutal, rund, zärtlich, farbig, obszön, geil, träumend, vernähend, verlernend, nass, trocken und herzschlagend sein. Wenn sie kalt ist, dann kalt wie ein Eisblock. Wenn sie heiß ist, dann so heiß wie ein Flammenflügel.» Österreichs Stararchitekt Wolf D. Prix referiert auch heute noch gerne seine Statements von damals, zum Teil sind sie mehr als 40 Jahre alt und von bemüht dialektischer Poesie. Er referiert sie, weil er den Medien, die ihm allesamt ohnehin huldigen, «einidruckn» will, dass er noch immer vom Geist des 68er-Revoluzzertums durchdrungen sei; selbst (oder insbesondere) sein 180 Meter hoher und 1,2 Milliarden teurer EZB-Turm in Frankfurt am Main sei ein Ausdruck der Kontinuität seiner «nicht angepassten» Architektur.
Die Bosse der EZB lieben eine aufs Ästhetische reduzierte Rhetorik, denn sie lenkt davon ab, dass für sie der Coop Himmelb(l)au-Turm eine Demonstration ihrer Machtstellung in Europa ist, genauso wie die Schwedenplatz-Skyline gegenüber der Wiener City eine Machtdemonstration der Raiffeisengruppe ist. Während die Gemeindebauten des Roten Wien sowohl Mittel zur Lösung der Wohnungsprobleme als auch Machtdemonstrationen der in Wien scheinbar unbesiegbaren Sozialdemokratie waren, lösen die heutigen Wolkenkratzer keines der urbanen Probleme (im Gegenteil) und sind immer in erster Linie Machtdemonstrationen. Sie gehören Investorengruppen, Konzernen und Banken und sind nie Gemeindebauten. Sie sind grundsätzlich nie errichtet worden, weil eine BürgerInneninitiative ein Hochhaus wollte. Hochhäuser kommen nie von unten.
Sie sind nie neutral, schon gar nicht, wenn sie sich als gläserner Phallus, Symbol für die Rolle der Europäischen Zentralbank bei der Unterwerfung der Politik, gegen das Himmelblau strecken. Neben der Europäischen Kommission und dem Internationalen Währungsfonds bildet die EZB jenes als «Troika» bekanntes Machtzentrum, das heute die Regierungen Griechenlands, Portugals und Spaniens kontrolliert und morgen alle europäischen Systeme außerhalb des Merkelismus. Prix, ein Geschöpf der 68er Revolte, kennt die Rolle der EZB. Deshalb «verhöhnt» er sie ja mit seiner Turmarchitektur, wie der raffinierten «Zeit» aufgefallen ist. Noch ein paar solche Verhöhnungen, und die EZB wird ihre Kolonialisierung der «Schuldnerstaaten» beleidigt ad acta legen.
Die Coop Himmelb(l)au, aus dem subkulturellen Rand des Aufruhrs der 60er Jahre kommend, ist nicht wie die meisten der populären Ex-RebellInnen in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern an einem oberen Punkt in der dritten Dimension. Gern erzählt Prix von oben – ob er das EZB-Zentrum eröffnet oder die Münchner BMW-Welt oder das neueste Vorzeigeprojekt in China –, dass sich seine Architektengruppe, «die immer ihrer Zeit voraus war», am 8. Mai 1968 gegründet habe, am Tag der Massendemonstration der Pariser StudentInnen. Sein Credo damals wie heute: Das Ziel der COOP Himmelb(l)au-Architektur sei, die Kraft der Gitarren von Hendrix, Richards oder Clapton in Architektur zu übersetzen. Im Gründungsmanifest, einer Hommage an die Unruhe, starteten die Avantgardisten einen Angriff auf den gefälligen Architekturdurchschnitt. Ihr Prinzip des Aufhebens, Auflösens, Brechens, Stehlens und Neuinterpretierens klassischer Elemente der Architektur zugunsten eines aufregenden Raumerlebnisses verschaffte ihnen die Ehre, zu den Dekonstruktivisten der Architekturbewegung gezählt zu werden.
Man konnte tatsächlich von einer Bewegung sprechen. Neben Coop Himmelb(l)au waren damals die Leute von Zünd-Up und von der Haus-Rucker Co aktiv. Alle drei Gruppen arbeiteten sehr oft in Grenzbereichen zwischen Architektur und Aktionskunst. In ihren ersten Projekten überprüften Coop Himmelb(l)au Signalübertragung, Musik und aktuelle Technologien im Hinblick auf ihre raumbildenden Qualitäten und um mögliche bewusstseinserweiternde Wirkungen der Architektur. Ihre revolutionären Projekte aus dieser Epoche tragen Namen wie «Die Wolke», «Unruhige Kugel» oder «Soul Flipper». Statt Banksterwolkenkratzer konzipierten sie aufblasbare Häuser für ihresgleichen als Wohn- und Lebensutopien für eine neue Zeit. Die Gruppe wollte sich aus der «Zwangsjacke des Funktionalismus» (Prix) emanzipieren, der zu Beginn der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts die Bauwelt dominierte.
Längst ist Coop Himmelb(l)au zu einer internationalen Marke mit zahlreichen MitarbeiterInnen und Büros in Wien und Los Angeles herangewachsen. Laut Qualitätsmedien zählen sie zu den Coolsten der global aktiven ÖsterreicherInnen, nur selten finden sich hier kritische Stimmen, nach denen Wolf D. Prix keine grundlegenden Neuerungen mehr erreiche, und ebenso selten wird ihm eine Verwässerung seiner Grundideen übel genommen. Prix’ Genosse Helmut Swiczinsky hat sich 2001 aus dem Business zurückgezogen.
Peter Noever organisierte 1992 im Museum für angewandte Kunst ein Symposion unter dem Titel «Architektur am Ende?». In dessen legendärem Katalog gibt es ein Vorwort des amerikanischen Architekten Frank Gehry, wo er sich über die revolutionäre Rhetorik von SymposionsteilnehmerInnen wie Zaha Hadid und Coop Himmelb(l)au Gedanken macht: «Ich kann mich daran erinnern, genauso gedacht zu haben wie sie, aber jetzt stellen sich die Dinge einfacher dar. Ich bin Architekt geworden, weil ich bauen wollte, und um bauen zu können, muss ich innerhalb des gesellschaftlichen Systems bauen(...) Ich bin letzten Endes zuversichtlich, dass alle die heute so rebellischen Kollegen Aufträge erhalten und wunderbare Bauten errichten werden, und nicht herumsitzen und sich Gedanken über das Ende der Architektur machen müssen.» Diese Prophezeiung vor 20 Jahren hatte Klasse.
Etablierter als die österreichische Weltmarke Coop Himmelblau ist heute nur die Marke Karl Marx-Hof. Sie ist ihrem Namenspatron zum Trotz etabliert, war im Juni 2014 in einem Essay der Neuen Zürcher Zeitung zu lesen. Zum Trotz? Mit Fortschreiten der kapitalistischen Krise wächst der Hype um Karl Marx, dessen schwächste Analyse des Kapitalismus genialer ist als die beste Länderspielanalyse Prohaskas. Aber im Grunde hat die NZZ recht: nicht in die Marx-Geburtsstadt Trier, sondern zur Ikone des «Roten Wien» strömen die TouristInnenmassen, denn der Karl Marx-Hof ist längst Fixpunkt jedes Wien-Tourismus, der mehr bieten will als Schönbrunn plus Dritter Mann plus Lipizzaner. TouristInnen, die sich theoretisch auskennen, was den (irreversiblen?) Weg der Sozialdemokratie von der Hoffnung des Proletariats zur brutalen Abtreibung jeglicher Aspekte des «Prinzips Hoffnung» betrifft, können diese sozialdemokratische Wende beschnuppern.
Sie müssen gar nicht über alle Maßen aufmerksam sein, um im Karl Marx-Hof auf Zeichen des Utopieverlustes zu stoßen. Auch der NZZ-Essayist ist unmittelbar fündig geworden:
«Wähler zu gewinnen, ist nützlich und notwendig, Sozialdemokraten zu erziehen, ist nützlicher und notwendiger», sagte Viktor Adler, der Gründer der Österreichischen Sozialistischen Arbeiterpartei. Das Vorhaben dürfte nur teilweise geglückt sein: Im idyllischen Innenhof des Karl Marx-Hofs, in dem akkurat gestutzte Rasenflächen, penibel gepflegte Rosenbeete und von Gartenzwergen bevölkerte Loggien eine etwas kleinbürgerliche Behaglichkeit ausstrahlen, ist von Solidarität und Internationalität keine Rede. Spricht man Bewohner auf ihre Lebensqualität an, dreht sich gleich alles um die «Ausländer». Eine ältere Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, schimpft beinahe klischeehaft über die schlechte neue Zeit; sie lebe längst in einem «Balkanhof». Dass der schwarzhaarige Mann mit slawischen Akzent, der während unseres Gesprächs am Eingangstor vorbei kommt, freundlich «Grüßgott» sagt, erleben sie zum ersten Mal.
(Georg Renöckl, NZZ 2. 6. 2014)
Dass sich das großbürgerliche Qualitätsblatt an der Mutation der ProletarierInnen, die1934 durch die Kanonen des Bundesheeres zur Flucht aus dem Karl Marx-Hof gezwungen waren, in gartenzwergpflegende Kleinbürger_innen stößt, bedient seinerseits ein Klischee. Auf rätselhafte Weise treffen JournalistInnen immer entweder auf kluge, alles-auf-den-Punkt-bringende Taxifahrer oder auf Frauen, die anonym bleiben wollen, die zu fiktiven Sprachrohren der Stereotypen werden. Weil ein Karl Marx-Hof-Urgestein niemals «Grüßgott», sondern stets «Guten Tag» sagen würde, ist der fiktive dunkelhaarige Nachzügler überangepasst.
Einmal hab ich vom Balkon einen Opa mit seinem Enkerl belauscht, die gerade am Karl-Marx-Hof entlang gingen. Auf die Frage, warum die Anlage Karl-Marx-Hof heiße, antwortete der Opa: "Da Karl Marx war der Heilige von die Roten, und darum heißt´s da auch Heiligenstadt." (Zitat aus "Der Karl-Marx-Hof" von Susanne Reppé, Picus Verlag).
Man könnte also auch, abseits der Welt der Klischees, auf Karl-Marx-HofbewohnerInnen treffen, die sich positiv auf die rote Geschichte des berühmtesten unter den Wiener Gemeindebauten beziehen: mit Stolz, doch gleichzeitig, wie in diesem Fall, mit Schmäh und Augenzwinkern. Der von der Schweizer Zeitung konstruierten «Gesamtmieterin», die sofort an die «Tschuschen» denkt, wenn man sie über die Lebensqualität befragt, stehen konkrete GemeindebaumieterInnen gegenüber, denen Solidarität kein Fremdwort ist und denen die Gartenzwergkolonie durchaus kein Favorit unter den Populationen des Marx-Hofes ist. Manche schämen sich fremd wegen der rotmützigen Gipsheiligen aus der heidnischen Epoche.
Widerspiegelt(e) der Umstand, dass man d e n Paradebau des Roten Wien bezog, sich im Bewusstsein der Wohnenden? Kompensierte das (imaginäre?) Privileg, im Karl-Marx-Hof zu wohnen, die doch relativ beengten Wohnverhältnisse (die durchschnittlichen Wohnungen waren 45 Quadratmeter groß, in ihnen lebten Familien, die im Schnitt doppelt so groß waren wie die heutigen Familien)? Fühlte man sich als Karl Marx-Hof-BewohnerIn als Teil einer Elite? Was bedeutet es heute, in einem Vorzeigeobjekt zu wohnen? Wie lebt man in einem Denkmal? Die Antworten darauf sind so unterschiedlich wie die aktuellen Mieter.
Es stimmt, das Ausmaß der Standardwohnungen (heute ist ein Teil von ihnen zusammengelegt) war relativ bescheiden. Aber im Vergleich zu den Löchern, die die neuen Gemeindebaumieter hinter sich ließen, gab es im Karl-Marx-Hof Traumbedingungen. In Susanne Reppés Buch über den Karl-Marx-Hof gibt es viele Angaben zur Wohnungsnot in Wien nach dem Ersten Weltkrieg. 1919 hatten nur 85 Prozent der Wohnungen eine Küche. 92 Prozent aller Wohnungen hatten das Klosett am Gang. 95 Prozent hatten die Wasserleitung am Gang. Nur sieben Prozent hatten elektrisches Licht. Da der Baugrund bis auf 15 Prozent verbaut wurde, gab es keine Höfe, in denen die Kinder spielen konnten. Die durchschnittliche Miete einer Arbeiterwohnung war höher als der Wochenlohn eines unqualifizierten Hilfsarbeiters, daher waren viele Familien gezwungen, zusätzlich «Bettgeher» aufzunehmen. In den Arbeiterfamilien hatte die Hälfte der Menschen kein eigenes Bett. Dass sich «Zimmer-Küche-Kabinett» das Arbeiterehepaar, drei Kinder und ein Bettgeher teilten, war die Regel.
In der «revolutionären» Phase des Karl-Marx-Hofes, bis 1934, war Kurt Treml ein Gschrapp im Vorschulalter. Die Frage, ob die Karl-Marx-Hof-Adresse als besonders ehrenhafte Adresse galt, oder ob im Bewusstsein der ersten Mieter Gemeindebau gleich Gemeindebau war, müsste man also an ältere Zeitzeugen richten. Herr Treml war sozusagen the next generation. Er stellte mehr dar als nur einen stolzen Karl-Marx-Hof-Mieter. Er war die Seele des Hofs. Er starb 2012, und ich bin froh, dass ich diese «Legende» des Gemeindebaus noch kennen lernen durfte. Er erzählte mir über seine Funktion als profaner Beichtvater des Gemeindebaus und über seinen Kampf dafür, dass die Mieten auch nach der Generalsanierung Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre erträglich blieben.
«Da gäb´s an Aufstand», sagte Kurt Treml auf die Frage, was passieren würde, wenn demnächst eine bürgerliche Rathausmehrheit auf den Gedanken käme, den roten Superblock umzubenennen (zum Beispiel in «Heiligenstädter Hof», wie er schon in der Nazizeit hieß). Für wie viele Mieter wäre die Sache wirklich einen Aufstand wert? Wir werden es hoffentlich nie wissen können. Einer wäre beim Aufstand gern dabei. Der Künstler Kurt Neuhold wohnt auch schon seit Beginn der 80er Jahre im Karl-Marx-Hof. Zunächst kokettierte er bloß mit der Adresse: Was kann einem jungen Linken besseres passieren, als mit Karl Marx zu sein? Später, sagt Neuhold, habe er begonnen, sich auf den Karl-Marx-Hof – als Nachbar, als politisch denkender Mensch, als Künstler – einzulassen. Doch das Verhältnis bleibt mehrfach gebrochen. Er blieb am Rande des «Dorfes» (und der dörflichen Intrigen, wie er die verzichtbaren Verdichtungen des sozialen Zusammenlebens im Gemeindebau nennt), und er bewahrt die liebevolle Distanz, die nötig ist, um die Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten der Sozial- und Architekturgeschichte des Karl-Marx-Hofes wahrzunehmen.
Zum Zweischneidigen Ja sagen und Mehrfachdeutungen zulassen. Dazu sollte auch die Ausstellung in der ehemaligen Wäscherei des Karl-Marx-Hofes anregen, die Kurt Neuhold in Zusammenarbeit mit dem Genossen Treml gestaltete (und, weil sie als work in progress konzipiert war, auch in Zukunft weiter gestalten wollte). Ein Abschnitt über die «Arisierungen» von Gemeindewohnungen am Beispiel des Karl-Marx-Hofes – um ein solches Thema hätten Ausstellungsgestalter bei früheren Jubiläen einen weiten Bogen gemacht – führte bald zu jenen erregten Debatten, die Neuhold im Grunde seines Herzens liebt. Aber auch andere Bereiche der Ausstellung sollten Nachdenkimpulse liefern. Als Neuhold die Nachbarschaft einlud, Gegenstände aus der Geschichte des Wohnens im Gemeindebau zur Verfügung zu stellen, um die Ausstellung wachsen zu lassen, schwebte ihm als Endzustand das Gegenteil eines herkömmlichen «Heimatmuseums» vor. «Das alte Stück ist willkommen, wenn es Zusammenhänge sichtbar macht und wenn von ihm aus der Versuch gemacht werden kann, das Jetzt begreifbar zu machen».
Ein «Heimatmuseum» schweigt und ist tot und leer, auch wenn es noch so voll mit alten Stücken ist. Doch als ein Mieter, wie man mir berichtete, den Gemeindebau-Aushang «Verhütung von Ruhestörungen» aus dem Jahre 1947 in die Ausstellung brachte, sorgte der Künstler dafür, dass Fragen auftauchen. Und daraufhin vielleicht auch Antworten, die nicht ganz zur Netiquette von Jubiläumsfeiern passen. «Lärmende Spiele» sind in der «ganzen Hofanlage» (also auch in den großräumigen grünen Höfen!) verboten; «die Eltern haben die Pflicht, in dieser Hinsicht auf die Kinder erziehlich einzuwirken»; «nach 22 Uhr ist das Singen in den Mieträumen verboten» – was sagt uns diese Obrigkeitssprache der 50 Jahre alten Karl-Marx-Hof-Hausordnung, gegenübergestellt der Revolutions- und Freiheitsrhetorik der Karl-Marx-Hof-Erbauer? War das Rote Wien gleichzeitig eine vorweggenommene Freiheitsutopie und eine Erziehungsanstalt für Untergebenenmentalität?
Kurt Treml gehörte nicht einer Generation an, die sich durch solche Fragen aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Erstens, sagte er mir damals, handle es sich hier um eine Hausordnung aus dem Jahre 1947, atme also den autoritären Geist von Austrofaschismus und Nazifaschismus. Aus den roten 30er Jahren könne er sich an derartige Reglementierungsversuche nicht erinnern; er selbst habe als Kind die übliche Freiheit des Kindes genossen. Zweitens, meinte er, gibt es auch heute Verbote, aber jeder wisse, dass jene, die für deren Einhaltung verantwortlich seien, auch wegschauen können.
Ein vergilbter, 50 Jahre alter Papierzettel regt zum Denken an, vielleicht sogar zum dialektischen. Ein Glücksfall. Kurt Neuholds Ausstellungskonzept (zu dem sich später ein Veranstaltungskonzept gesellen sollte, so sein Plan) war offen genug, um weitere Glücksfälle zu generieren. Für den (zuagrasten) Künstler ist diese sehr aktive Art von Auseinandersetzung mit lokaler Geschichte die optimale Form, im Stadtteil persönlich Wurzeln zu schlagen.
Ich schlendere durch den Durchfahrtsbogen im Mitteltrakt des Karl-Marx-Hofes, der den 12. Februar-Platz mit dem Heiligenstädter Bahnhofsgebäude verbindet. Man hat nicht den Eindruck, dass es einem die Stimmung hebt, wenn man dieses Gewölbe passiert. Doch man hat bei Susanne Reppé gelesen, wann es Stimmung gab: damals jeden Sonntag nämlich, wenn auf der Hohen Warte die Vienna kickte und bis zu 40.000 Menschen, vom S-Bahnhof zum Fußballplatz unterwegs, durch die Bögen zogen, die damit zu Triumphbögen des Wiener Proletariats wurden. Und sie wurden nicht zufällig zu solchen. Die Planer hatten sich bewusst diesen Umstand zunutze gemacht, um die dominierende Wirkung des Bogens zu unterstreichen. «Was sagt uns das?», meint Neuhold. «Die Kritiker haben recht, wenn sie den Vorwurf machen, der Karl-Marx-Hof sei Missbrauch der Architektur für politische Propaganda. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Der Karl-Marx-Hof war vor allem Ausdruck einer sozialen Utopie: Paläste für jene Klasse, für die es bisher nur Hütten gab.»
Kurt Treml, der alte Sozi, und Kurt Neuhold, der junge Künstler, waren ein ideales Duo. Ihr Projekt einer lebendigen, wachsenden, demokratischen, partizipatorischen, antifaschistischen Karl-Marx-Hof-Ausstellung im ehemaligen Waschsalon der Gemeindebauanlage (Eingang Halteraustraße) hätte den Bonus der doppelten Perspektive ausspielen können: die Sicht des Künstlers, synthetisiert mit der Sicht des Mietervertreters und Langzeitbewohners. Der städtischen Wohnhäuserverwaltung und der Stadtregierung hätten nichts Schöneres passieren können als eine Selbstorganisation der Erinnerungsarbeit, ein nicht von außen aufgezwungenes, sondern ein aus dem Inneren des Superblocks heranreifendes Verantwortungsbewusstsein. Die Stadtverwaltung hat es aber dann abgelehnt, mit «Unabhängigen» zusammen zu arbeiten. Tremls und Neuholds Aufbauwerk wurde als nichtig erklärt. Der Waschsalon, den die beiden wachgeküsst hatten, wurde zum offiziellen «Rotes Wien»-Museum der Partei. Die Dauerausstellung im Waschsalon ist nichtsdestotrotz empfehlenswert. Aber sie verzichtet darauf, Fragen zu stellen, die auf die Tragik der Geschichte der Sozialdemokratie verweisen. Eine dieser Fragen lautete: Warum ist der SP nie etwas anderes eingefallen als den Kapitalismus zu retten? Und ist nicht auch das Wohnbauprogramm des Roten Wien für dieses übergeordnete Rettungsprogramm funktionalisiert worden? Ich muss mir noch viele Diskussionen über das «Rote Wien» anhören, bevor ich mir anmaße, solche Rätsel zu lösen.
Robert Sommer
INFO-BOX
Das Rote Wien | Waschsalon:
http://dasrotewien-waschsalon.at/
SEITENANFANG